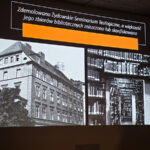Wie jedes Jahr wird mit einem Gedenkmarsch des Gegenseitigen Respekts an die Pogromnacht am 9. November 1938 erinnert
Wie jedes Jahr wird mit einem Gedenkmarsch des Gegenseitigen Respekts an die Pogromnacht am 9. November 1938 erinnert
Auch andere Veranstaltungen finden statt.
Im Andenken an die Pogromnacht vom Jahr 1938 findet alljährig in Breslau (Wrocław) der Gedenkmarsch – bekannt als „Marsch des Gegenseitigen Respekts“ – statt. Der Marsch wird von der Jüdischen Gemeinde in Erinnerung an die jüdischen Opfer der Pogromnacht und die Opfer des Zweiten Weltkrieges organisiert. Er startet am 9. November um 18 Uhr im Hof der Synagoge zum Weißen Storch und endet an dem Gedenkstein, der an der Stelle steht, wo einst die Neue Synagoge stand. Diese wurde in der Pogromnacht 1938 angezündet und dann weggesprengt. Vor dem Marsch finden in der Synagoge ein Konzert (17 Uhr) und Reden der offiziellen Gäste im Innenhof der Synagoge (18 Uhr) statt. Der Eintritt für alle Ereignisse ist frei.
In diesem Jahr wurde der Gedenktag um einen Vortrag ergänzt, der bereits am 6. November stattgefunden hat. Dr. Renata Wilkoszewska-Krakowska, Kuratorin am Breslauer Stadtmuseum, stellte in ihrem Vortrag die Geschichte der Breslauer Pogromnacht und auch die Unterscheidung zwischen der „Kristallnacht“ und der „Pogromnacht“ vor. Der Begriff „Kristallnacht“ oder „Reichskristallnacht“ sollte an das Glas aus den zerbrochenen Schaufenstern und Scheiben erinnern. In der Wirklichkeit kann er aber auch den damit beabsichtigten Prozess der „Kristallisierung“, also der „Reinigung“ des deutschen Volkes von den jüdischen Mitbürgern bedeuten, deshalb wird dieser Begriff von den Forschern und Historikern vermieden. Angesicht der Geschehnisse der Nacht des 9. Novembers 1938 ist der Begriff „Pogromnacht“ völlig gerechtfertigt.
Der Pogrom kam in Breslau besonders in der Zerstörung der Neuen Synagoge (Synagoge am Anger), die nach der Berliner Synagoge die zweitgrößte Synagoge in Deutschland war, zum Vorschein. Die Zerstörung wurde nicht nur zum Symbol der Vernichtung des Gebäudes selbst, sondern zum Symbol der Vernichtung aller Errungenschaften des jüdischen Volkes, das sich seit 1870er Jahren voller Freiheit und Gleichberechtigung in Breslau erfreute. Die Mehrheit der Breslauer Juden waren von den Aufklärungsideen beeinflusst (der sog. Haskala) und konzentrierte sich um den Rabbiner Abraham Geiger, der den reformierten Judaismus repräsentierte. Der weltoffene, assimilierte und reformierte Teil baute zuerst die Alte Synagoge (Synagoge zum Weißen Storch) und später, als sie sich zu klein erwies, die Neue Synagoge. Die alte wurde dem zweiten Teil – dem konservativen Teil der jüdischen Gemeinde übergeben. Im Vorkriegsbreslau funktionierten zwei Kultuskommissionen nebeneinander.
Der direkte Grund für den Pogrom der Juden war die politische Ermordung des Sekretärs der deutschen Botschaft in Paris, Ernst von Rath (1909-1938), eines Mitglieds der NSDAP, durch den 17-jährigen Herschel Grynszpan (1921-1942) am 7. November 1938. Die deutsche Propaganda nutzte den Anschlag, um eine verstärkte antisemitische Kampagne einzuleiten und bezeichnete ihn als „Angriff des internationalen Judentums auf das Deutsche Reich“. In Breslau begann die antijüdische „Protestaktion“ gemäß dem Befehl des Reichsführers Heinrich Himmler am 9. November 1938 um 1:30 Uhr. Der Pogrom in Breslau wurde von der SS durchgeführt. Am 10. November um 15 Uhr sandte SS-Oberführer Fritz Katzmann einen vorläufigen Bericht an seine Vorgesetzten, indem er die Ergebnisse ernannte. Dabei wurde berichtet, das eine Synagoge niedergebrannt (die Neue Synagoge) und zwei weitere verwüstet wurden (u.a. die Storchsynagoge, in der man die Tora-Rollen, den Toraschrein „Aron ha-Kodesch“ vernichtete und die silbernen Ritualgefäße raubte). Mindestens 500 jüdische Geschäfte und 10 jüdische Gasthäuser wurden vollständig zerstört. Auch das Jüdische Theologische Seminar wurde beschädigt und der Großteil seiner Bibliotheksbestände wurde zerstört oder beschlagnahmt. Die Polizei verhaftete etwa 600 Männer, die in das Konzentrationslager Buchenwald geschickt wurden. Für die Organisation und Durchführung des Pogroms war der Höhere SS- und Polizeiführer, Erich von dem Bach, verantwortlich.
Am 11. November wurden weitere 1.000 bis 1.500 Männer verhaftet und unter Aufsicht bewaffneter Polizisten zum Bahnhof getrieben. Um 22 Uhr wurden sie in einen Sonderzug verladen, der in Weimar eintraf und noch am selben Morgen weiter nach Buchenwald fuhr. Über die tragischen Geschehnisse hat Dr. Willy Cohn geschrieben. Seine Tagebücher wurden später in Form des Buches „Kein Recht. Nirgends.“ veröffentlicht. Er selbst wurde mit seiner Frau und zwei kleinen Töchterchen mit dem ersten großen Transport 1941 nach Kaunas gebracht und erschossen.
Die Ereignisse in Breslau waren ein Teil der landesweiten Operation. Die Nazis verhafteten 30.000 Männer im Alter von 18 bis 80 Jahren und deportierten sie in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen. Über 100 starben an den Folgen von Misshandlungen oder psychischen Traumata. Einer der Beispiele bildete der Breslauer Künstler Heinrich Tischler, der dank den Bemühungen seiner Frau im Dezember aus Dachau entlassen wurde, infolge der Misshandlung aber kurz danach im Krankenhaus starb. Sehr viele jüdische Bürger begangen den Selbstmord: für die Meisten, die sich vollständig als deutsche assimilierte Bürger gefühlt haben, waren die grausamen Gewalttaten schockierend. Plötzlich wurden sie der eigenen Heimat, der Würde und des Eigentums beraubt und konnten sich in der neuen Wirklichkeit nicht zurechtfinden.
Mit der Durchführung der Pogromnacht ließ der deutsche Staat den Schleier der Täuschung fallen lassen. Ab jetzt kamen die offenen Auftritte und die Gewalt gegenüber jüdischen Mitbürgern zum Vorschein, die letztendlich mit der Shoa endeten.
Text und Bilder (anhand des Vortrags von Dr. R. Wilkoszewska-Krakowska): Małgorzata Urlich-Kornacka