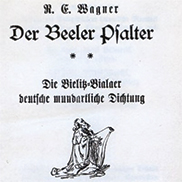 Sechseinhalb Jahrhunderte lang war der Bielitzer Dialekt im schlesisch-galizischen Grenzland beheimatet
Sechseinhalb Jahrhunderte lang war der Bielitzer Dialekt im schlesisch-galizischen Grenzland beheimatet
Heute sprechen ihn nur wenige Menschen. Für Sprachwissenschaftler ist er zum spannenden Forschungsgegenstand geworden.
Nur eine Handvoll Menschen sprechen heute noch den Bielitzer Dialekt. Das Jahr 1945 markierte das Ende der Bielitz-Bialaer deutschen Sprachinsel und somit grundsätzlich auch das Ende des aktiven Gebrauchts einer Sprache, die sechseinhalb Jahrhunderte lang im schlesisch-galizischen Grenzland beheimatet war.
Die Bielitzer Sprachinsel entstand im späten 13. Jahrhundert infolge einer Besiedlungsaktion der Herzöge von Teschen (Cieszyn). Bis dahin existierten in der dortigen Gegend nur verstreute slawische Siedlungen. Die Fläche des deutschsprachigen Gebietes variierte im Laufe der Jahrhunderte. An der Schwelle des 19. und des 20. Jahrhunderts umfasste sie außer der schlesischen Stadt Bielitz (Bielsko) und der galizischen bzw. kleinpolnischen Stadt Biala (Biała) auch ca. 15 weitere Orte des Umlandes. Die meisten von ihnen lagen am schlesischen Ufer des Flusses Bialka, der dort seit dem Mittelalter die Staats- bzw. die Regionalgrenze bildete. Anzumerken sei an dieser Stelle, dass sich in den beiden genannten Städten seit Mitte des 19. Jahrhunderts das Hochdeutsche immer mehr als Umgangssprache durchsetzte.

Die Vertreibung der großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung im Jahr 1945 bedeutete auch das Ende des Dialekts im Raum Bielitz-Biala (seit 1951 bilden die beiden Orte eine Stadt). Die einzige Ausnahme stellte das im galizischen Teil der ehemaligen Sprachinsel gelegene Wilemsau (Wilamowice) dar. Wegen ihrer vermeintlich niederländischen Herkunft konnten die Einwohner dieses Städtchens mehrheitlich der Vertreibung entgehen, allerdings war der Gebrauch des Dialekts in der Öffentlichkeit bis 1989 verboten. Nach dem Fall des Kommunismus wurden dort mehrere Initiativen zu seiner Wiederbelebung und Förderung unternommen. Entgegen den sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen wird der Dialekt von seinen Trägern vor Ort jedoch nicht als Bielitzer Dialekt der deutschen Sprache, sondern als „Wymysiöeryś“ (also Wilemsauerisch) bezeichnet.
Zu den wenigen polnischen Philologen, die sich heute mit dem Dialekt der Bielitzer Sprachinsel auseinandersetzen, gehört Dr. Grzegorz Chromik von der Jagiellonen-Universität in Krakau (Kraków). Dieses Interesse erklärt sich bei ihm aus seiner Familiengeschichte. Das Bielitzer Deutsch war nämlich die Muttersprache seiner Mutter, die aus Kamitz (Kamienica), heute Stadtteil von Bielitz-Biala stammte. Der Wissenschaftler verfasste mehrere Veröffentlichungen zu den Sprachen des Teschener Landes, in dem auch Bielitz liegt. Eine kleine Auswahl der online zugänglichen Texte befindet sich am Ende des vorliegenden Beitrags.

Wie Dr. Chromik betont, teilte sich der Dialekt, der insgesamt auf einer relativ kleinen Fläche gesprochen wurde, in eine westliche und eine östliche Mundart. Interessanterweise deckte sich diese Trennung nicht mit der schlesisch-galizischen Grenze. Da das Teschener Schlesien und Galizien Teile der Habsburgermonarchie waren (wobei Galizien viel kürzer: nur knapp 150 Jahre), hatte das Bielitzer Deutsch einen leichten österreichischen Hauch. Dennoch klassifiziert es der Wissenschaftler ohne jeden Zweifel als einen ostmitteldeutschen Dialekt. Die Forschungen von Dr. Chromik ergaben, dass die ersten Siedler aus dem Raum Waldenburg (Wałbrzych) gekommen waren.

Im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzten sich mit dem Dialekt mehrere Sprachwissenschaftler und Lokalhistoriker auseinander. Im Jahr 1935 erschien beispielsweise auf Initiative von Richard Wagner, dem evangelischen Pfarrer in Bielitz, das Buch „Beeler Psalter“, das vor allem im 19. Jahrhundert verfasste Gedichte enthält. Das in Frakturschrift gedruckte Buch ist in der Schlesischen Digitalbibliothek verfügbar.
Erste Strophe des Gedichts „Ens’re alde Hajmetsproch“ aus dem Buch „Der Beeler Psalter“:
Wou ei de scheine alde Zait,
Wie ens’re Hajmetsproch met Lost
Bai ens erscholl ver olla Leut’?
An, wie vo Vögerla om Ost,
De alda Liedla rajn erklonga,
Vo Orm an Raich met Frajd gesonga.
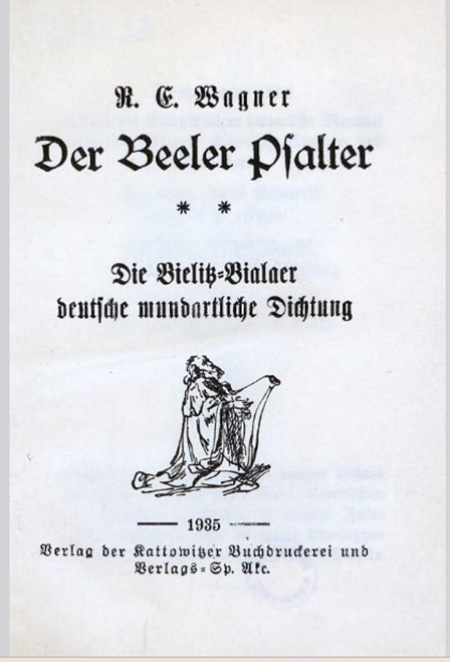
Eine Auswahl der online zugänglichen Beiträge über die sprachlichen Verhältnisse im Raum Bielitz-Biala und im Teschener Land aus der Feder von Dr. Grzegorz Chromik:
- Geschichte des deutsch-slawischen Sprachkontaktes im Teschener Schlesien
- Zur Differenziertheit der deutschen Dialekte im ehemaligen Kronland Österreichisch-Schlesien
- Das Kronland Österreichisch-Schlesien und sein sprachliches Potpourri
- Die Familiennamen der deutschen Sprachinsel Bielitz: Probleme der Namenforschung in einer Sprachinsel
- Sprachliche Verhältnisse im heutigen polnischen Teil des Teschener Schlesiens: ein historischer Überblick
- Mittelalterliche deutsche Sprachinseln in Oberschlesien, Kleinpolen und Rotreußen
Text: Dawid Smolorz
