 Kurz nach dem deutschen Überfall auf Polen schloss sich am 17. September 1939 die Sowjetunion der Aggression an
Kurz nach dem deutschen Überfall auf Polen schloss sich am 17. September 1939 die Sowjetunion der Aggression an
Damit wurde das Schicksal polnischer Bürger aus Oberschlesien besiegelt, die es in die östlichen Gebiete verschlagen hatte.
Zweieinhalb Wochen nach dem deutschen Überfall auf Polen schloss sich am 17. September 1939 die Sowjetunion als Verbündeter des Dritten Reiches der Aggression an. Mit diesem Dolchstoß wurde nicht nur das Schicksal des Landes, sondern auch das Schicksal jener polnischen Bürger aus Oberschlesien besiegelt, die es in die Gebiete östlich von Bug und San verschlagen hatte.

Als Offiziere der polnischen Armee, polnische Grenzbeamte und Polizeibeamte der autonomen Woiwodschaft Schlesien nahmen sie vor dem 17. September 1939 an den Kämpfen gegen die deutsche Wehrmacht teil bzw. zogen sie sich mit ihren Einheiten in die bis dahin weitgehend sicheren Ostgebiete Polens zurück. Nach deren Eroberung durch die Rote Armee gerieten sie bis Anfang Oktober in die sowjetische Gefangenschaft. Während die meisten „einfachen“ Soldaten mit festem Wohnsitz in den an das Reich angeschlossenen Gebieten – darunter Ostoberschlesien – heimkehren durften, wurden Offiziere, Angehörige der Polizei und des Grenzschutzes sowie Vertreter der intellektuellen Elite in Sonderlagern interniert. Mit dem geheimen Beschluss des Moskauer Politbüros vom 5. März 1940 wurden ca. 22.000 polnische Staatsangehörige, eingestuft als „eingeschworene Feinde der Sowjetmacht“, zum Tode verurteilt.

Organisierte Massenhinrichtungen begannen im April 1940 an mehreren Orten der westlichen Sowjetunion, vor allem in dem Gefängnis von Twer sowie in den Wäldern von Katyn und Pjatychatky (heute Teil von Charkiw). Unter den Opfern aus Oberschlesien machten die Beamten der Polizei der Woiwodschaft Schlesien und die ehemaligen schlesischen Aufständischen die größte Gruppe aus. Die ersteren gerieten meistens bei ihrem Rückzug in Richtung Osten in die sowjetische Gefangenschaft (s. SILESIA News ). Die letzteren waren sich wiederum dessen bewusst, dass ihnen Lebensgefahr drohen würde, falls sie den Deutschen in die Hände fallen würden. Deswegen zogen sie entweder mit ihren Truppen oder auf eigene Faust in die Südostgebiete der Zweiten Polnischen Republik, wo auch sie nach dem 17. September von den Rotarmisten inhaftiert wurden. Da die meisten von ihnen Offiziere der Reserve waren, galten sie bei den Sowjets als „unumerziehbare“ Feinde des kommunistischen Systems. Als prominentester Vertreter dieser Gruppe gilt Karol Grzesik. Der aus dem Raum Ratibor (Racibórz) gebürtige Mann war Mitglied des Warschauer Parlaments und letzter Marschall des Schlesischen Sejm. Er wurde im Mai 1940 in Kiew vom NKWD ermordet.
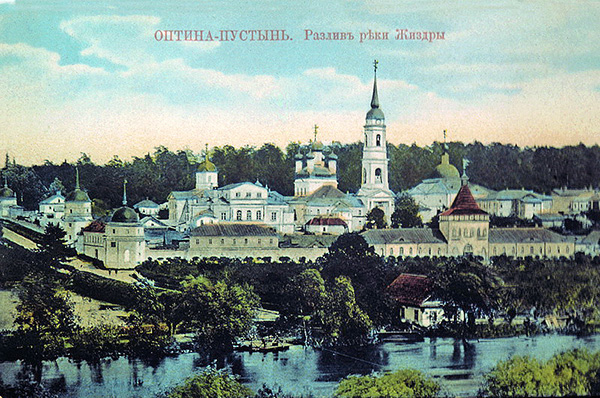

Obwohl innerhalb der polnischen Bevölkerung kein Zweifel bezüglich der Täterschaft an den Massakern von Katyn, Twer und Charkiw bestand, war die organisierte Ermordung polnischer Bürger im Frühjahr 1940 bis zur politischen Wende von 1989 ein Tabu. Bis dahin durfte in diesem Zusammenhang – wenn überhaupt – ausschließlich von deutscher Schuld gesprochen werden.

Text: Dawid Smolorz
